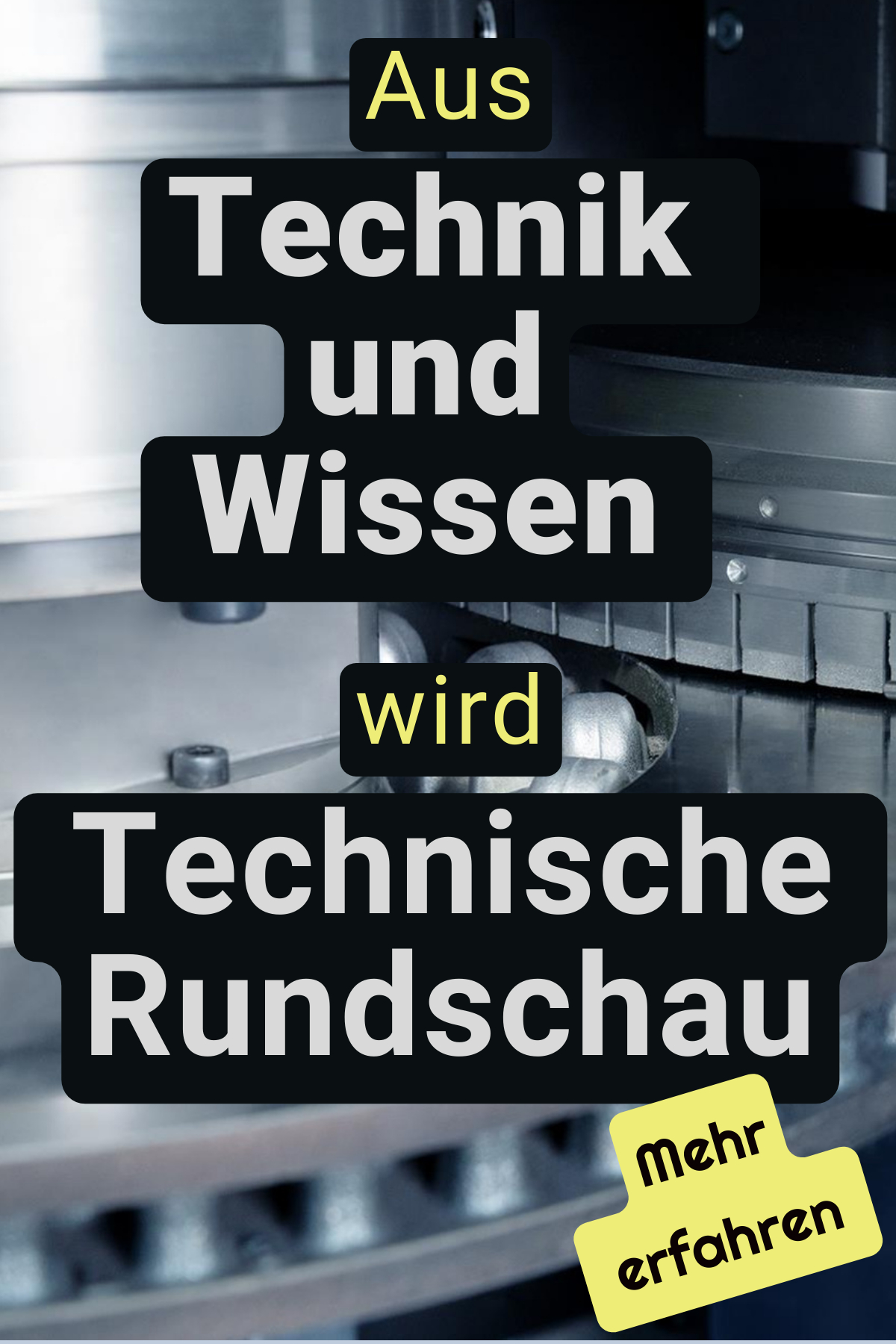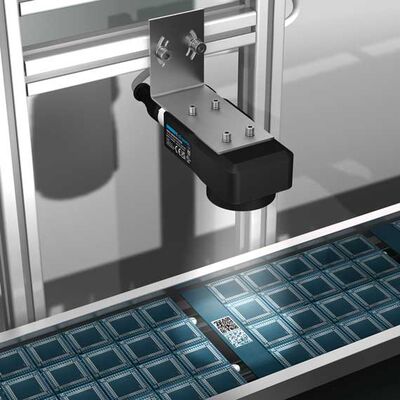Am Swissmem-Symposium 2025 traf sich die Schweizer Industrie, um über Zölle, Robotik und Resilienz zu sprechen. Zwischen Sackgassen und neuen Wegen zeigte sich: Wer bestehen will, braucht Mut – und die Bereitschaft, auch im Regen nach vorne zu schauen – oder sich in der Sackgasse einfach mal umzudrehen.
Als Medienpartner des Symposiums war die «Technische Rundschau» (Technik und Wissen*) mitten im Geschehen und berichtet in einer Serie über die wichtigsten Vorträge und Roundtable-Gespräch. *Die «Technische Rundschau» gehört neu zu «Technik und Wissen». Ab 2026 bündeln wir alles unter der Traditionsmarke «Technische Rundschau» - auch diese Webseite.
Am Morgen hing schwerer Regen über dem Zürichsee. Wer im Lake Side ankam, hastete mit hochgezogenen Schultern durch die Pfützen, die Haare feucht, das Jackett an den Schultern dunkel gefleckt. Keine leichte Kulisse für ein Treffen, das Antworten auf die Zukunft finden sollte. Doch vielleicht passte es gerade so: draussen das Grau, drinnen die Suche nach Licht.
Das Swissmem-Symposium 2025 stand unter einem doppelten Vorzeichen. Einerseits die nackten Zahlen: Exporte rückläufig, Zölle von 39 Prozent auf dem US-Markt, Einbrüche in Schlüsselbranchen. Andererseits die Haltung, die an diesem Tag beschworen wurde: «Zukunftsfreude». Ein Wort, das vielen im Saal erst einmal ungewöhnlich vorkam. Doch das in einem der Vorträge erwähnte Wort zog sich (fast) wie ein roter Faden durch die Diskussionen – als Gegengift gegen die lähmende Unsicherheit der Gegenwart.
Eine Branche im Gegenwind
Dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass die Schweiz in der Spitzentechnologie mitreden kann, war allen klar. Die exportorientierte Industrie lebt von offenen Märkten, von Stabilität, von verlässlichen Partnern. Und genau das bricht derzeit weg.
Martin Hirzel, Präsident von Swissmem, sprach es nüchtern aus: «Wir kämpfen, wir suchen neue Absatzmärkte, neue Geschäftsmodelle – wir geben nicht auf. Aber ein Drittel unserer Mitglieder prüft inzwischen Produktionsstandorte ausserhalb der Schweiz. Das haben wir so noch nie gehört.»
Hinter diesem Satz steckt mehr als eine Standortfrage. Er ist Ausdruck einer tektonischen Verschiebung: Was, wenn der bisherige Wohlstandsmodus – Hochtechnologie in die Welt, Weltmarkt als Garant – nicht mehr funktioniert? Was, wenn «Made in Switzerland» an Grenzen stösst, die nicht technologisch, sondern politisch gezogen werden?
Im Bild: Helmut Ruhl, CEO der AMAG
Sackgasse als Möglichkeit
Die Automobilindustrie ist ein Brennglas dieser Entwicklung. Jahrzehntelang garantierte sie Grossserien, stabile Wertschöpfungsketten, verlässliche Planung. Nun aber scheint sie wie gelähmt: sinkende Absätze, Überkapazitäten, Verdrängungskämpfe.
Helmut Ruhl, CEO der AMAG, setzte ein Bild dagegen: «Jeder kennt eine Sackgasse. Aber wenn man darin umkehrt, ist die Welt wieder offen.» Für ihn bedeutet diese Wende: Elektromobilität und erneuerbare Energien nicht länger als Zusatzgeschäft, sondern als Kern des Modells zu denken.
Die Botschaft war klar: Wer jetzt nicht investiert, wer weiter nur an den Verbrenner glaubt, verpasst nicht nur Märkte, sondern die Chance, neue Wertschöpfung überhaupt zu sichern. AMAG koppelt deshalb die E-Mobilität mit Photovoltaik, setzt auf Kreislaufwirtschaft, testet synthetische Kraftstoffe aus Schweizer Spin-offs.
Warum? Weil der Umbruch tiefer reicht als einzelne Modelle. Wenn Autos zu rollenden Computern werden, ist das Geschäftsmodell nicht mehr das Auto selbst, sondern die Plattform. Daten, Software, Services – hier entscheidet sich, ob Europa und die Schweiz überhaupt noch eine Rolle spielen.

Im Bild: Helmut Ruhl, CEO der AMAG
Sackgasse als Möglichkeit
Die Automobilindustrie ist ein Brennglas dieser Entwicklung. Jahrzehntelang garantierte sie Grossserien, stabile Wertschöpfungsketten, verlässliche Planung. Nun aber scheint sie wie gelähmt: sinkende Absätze, Überkapazitäten, Verdrängungskämpfe.
Helmut Ruhl, CEO der AMAG, setzte ein Bild dagegen: «Jeder kennt eine Sackgasse. Aber wenn man darin umkehrt, ist die Welt wieder offen.» Für ihn bedeutet diese Wende: Elektromobilität und erneuerbare Energien nicht länger als Zusatzgeschäft, sondern als Kern des Modells zu denken.
Die Botschaft war klar: Wer jetzt nicht investiert, wer weiter nur an den Verbrenner glaubt, verpasst nicht nur Märkte, sondern die Chance, neue Wertschöpfung überhaupt zu sichern. AMAG koppelt deshalb die E-Mobilität mit Photovoltaik, setzt auf Kreislaufwirtschaft, testet synthetische Kraftstoffe aus Schweizer Spin-offs.
Warum? Weil der Umbruch tiefer reicht als einzelne Modelle. Wenn Autos zu rollenden Computern werden, ist das Geschäftsmodell nicht mehr das Auto selbst, sondern die Plattform. Daten, Software, Services – hier entscheidet sich, ob Europa und die Schweiz überhaupt noch eine Rolle spielen.
Im Bild: Pero Micic, Experte für Zukunftsmanagement
Zukunftsfreude als Haltung
«Zukunftsfreude ist das Einzige, was Zukunftsangst neutralisiert», rief der Pero Micic, einer der führenden Experten für Zukunftsmanagement, ins Auditorium. Er sprach nicht von blindem Optimismus, sondern von einer bewusst gewählten Haltung. Ohne diese Freude, so seine These, werde nicht investiert, werde nur verteidigt.
Sein Argument: neue Technologie bietet heute mehr Gründe für Hoffnung, als wir oft wahrhaben wollen. Krebs könnte in den kommenden Jahrzehnten besiegbar sein. Batterien halten millionenfache Ladezyklen. Solar- und Windenergie wachsen schneller als jede andere Energieform zuvor.
Das Warum liegt darin, dass Angst lähmt. Wer in Unternehmen nur verteidigt, erstarrt. Wer aber Freude an Möglichkeiten entwickelt, und erkennt, welche Technologien nun kommen werden, schafft Kultur für Investitionen. Zukunftsfreude ist, im Kern, ein ökonomischer Treiber.

Im Bild: Pero Micic, Experte für Zukunftsmanagement
Zukunftsfreude als Haltung
«Zukunftsfreude ist das Einzige, was Zukunftsangst neutralisiert», rief der Pero Micic, einer der führenden Experten für Zukunftsmanagement, ins Auditorium. Er sprach nicht von blindem Optimismus, sondern von einer bewusst gewählten Haltung. Ohne diese Freude, so seine These, werde nicht investiert, werde nur verteidigt.
Sein Argument: neue Technologie bietet heute mehr Gründe für Hoffnung, als wir oft wahrhaben wollen. Krebs könnte in den kommenden Jahrzehnten besiegbar sein. Batterien halten millionenfache Ladezyklen. Solar- und Windenergie wachsen schneller als jede andere Energieform zuvor.
Das Warum liegt darin, dass Angst lähmt. Wer in Unternehmen nur verteidigt, erstarrt. Wer aber Freude an Möglichkeiten entwickelt, und erkennt, welche Technologien nun kommen werden, schafft Kultur für Investitionen. Zukunftsfreude ist, im Kern, ein ökonomischer Treiber.
Roboter zwischen Mythos und Realität
Jacques Lemire aus Kanada sprach über humanoide Roboter – ein Thema, das fasziniert und verunsichert zugleich. Milliarden fliessen in Start-ups, Videos in sozialen Medien zeigen tanzende Maschinen, die wie Science Fiction wirken.
Lemire relativierte: «Glauben Sie nicht alles, was Sie auf YouTube sehen.» Noch koste ein Humanoid 150’000 Dollar in der Herstellung – marktfähig wäre er erst bei 5’000. Das Problem seien weniger Motoren und Sensoren, sondern die schiere Energie, die nötig ist, um menschenähnliche Bewegungen zu simulieren.
Aber auch hier das Muster: Die Technologie mag unreif sein, doch das Feld öffnet sich. Wer rechtzeitig Kompetenzen aufbaut – in Mechanik, Software, Daten – kann mitreden. Humanoide Roboter sind noch nicht der Alltag, aber sie sind ein Symbol dafür, wie sich Branchen neu erfinden müssen: schneller, risikobereiter, mutiger.









Die Rückkehr der Rüstung
Und dann kam Oliver Dürr, CEO von Rheinmetall Air Defence. Er begann mit den Worten: «Ich bin heute der Partycrasher.» Statt Visionen und Zukunftsbildern sprach er über harte Realität: Krieg, Drohnen, Verteidigungsfähigkeit.
«Früher haben wir uns versteckt», sagte er, «heute wollen plötzlich alle unsere Produkte.» Er schilderte, wie seine Firma an der Eröffnung einer neuen Artilleriefabrik in Deutschland beteiligt war – ein Werk, das in nur 14 Monaten gebaut wurde. Was früher undenkbar schien, gilt heute als notwendig.
Besonders eindringlich wurde Dürr, als er über die Rolle der Zulieferer sprach. «70 Prozent unserer Wertschöpfung liegen bei Partnern. Wenn die nicht liefern, stehen wir still.» Und er fügte hinzu: «Wir erwarten nicht nur Teile. Wir erwarten, dass Zulieferer Verantwortung übernehmen, Risiken mittragen, Qualität liefern, ohne dass wir jede Schraube vorgeben müssen.»
Hier lag ein tieferes Warum: Verteidigungsfähigkeit ist nicht allein Sache eines Konzerns. Sie hängt an Netzwerken, an mittelständischen Zulieferern, an einem Ökosystem, das funktionieren muss. Technologie ist nicht isoliert, sie ist eingebettet – und diese Einbettung ist heute wieder sicherheitspolitisch relevant.
Antworten auf fundamentale Fragen finden
Was das Symposium in Zürich zeigte: Es war kein oberflächliches Schlagabtausch-Event, sondern der Versuch, Antworten auf fundamentale Fragen zu finden.
Wie verteidigt ein kleines Land wie die Schweiz seine industrielle Basis in einer Welt, die sich in Blöcke aufspaltet? Wie bleiben Unternehmen innovationsfähig, wenn Märkte politisch blockiert werden?
Wie lässt sich technologische Transformation so gestalten, dass sie nicht nur Kosten, sondern auch neue Wertschöpfung bringt?
Der rote Faden war nicht «alles wird gut», sondern: Alles verändert sich. Und wer bestehen will, muss Haltung zeigen und Freude daran haben, sich nach den neuen Technologien auszurichten und sie für das eigene Unternehmen zu nutzen. Dann sind auch Regen und US-Zölle verkraftbar(er).
Die zehn wichtigsten Erkenntnisse
- Die Schweizer Tech-Industrie kämpft mit Rezession und Zöllen – und denkt über Produktionsverlagerungen nach.
- Offene Märkte sind keine Selbstverständlichkeit mehr; Europa bleibt der wichtigste Anker.
- Die Autoindustrie muss sich neu erfinden: nicht nur im Antrieb, sondern als Plattformwirtschaft.
- Zukunftsfreude ist ein ökonomischer Faktor – ohne sie gibt es keine Investitionen.
- Chinas Tempo bei Elektromobilität und Solar zeigt, wie schnell sich Märkte verschieben.
- Humanoide Roboter sind noch teuer, aber Symbol für den Sprung in neue Äras.
- Die Rolle der Zulieferer wird in jeder Branche wichtiger – Verantwortung verteilt sich neu.
- Verteidigungsindustrie ist zurück in der Mitte der Industriepolitik – auch in der Schweiz.
- Resilienz allein reicht nicht; Unternehmen müssen offensiv denken.
- Wandel erfordert Mut – und die Bereitschaft, im Regen zu stehen und dennoch nach vorne zu schauen.
Passend zu diesem Artikel
Impressum
Text: Eugen Albisser
Bilder: Swissmem
Redaktionelle Bearbeitung: Technik und Wissen
Informationen
Firma
Weitere Artikel
Veröffentlicht am: