Geringe Kapitalbindung
- Geringer Budgetbedarf für Erstinvestition.
- Mehr finanzielle Freiheit für Kunden.



Es war eine illustre Diskussionsrunde, die sich an einem frühen Morgen auf der Messe Ble.ch am Stand der Firma Trumpf traf.
Drei Vertreter von etablierten Blechbearbeitungsfirmen waren anwesend, drei Experten der Firma Trumpf, ein Verbandsdirektor und ein Moderator. Ausserdem hatte Trumpf einen auserlesenen Kreis an Zuhörer eingeladen.
Das Setting: Der Stand der Firma Trumpf auf der Messe Ble.ch, wo man bereits in die digitalisierte Produktion eintauchen konnte. Die Besucher hatten dort die Gelegenheit, sich eine personalisierte Glocke abzuholen, die direkt auf dem Stand gefertigt wurde. Dafür wurde der Auftrag mittels eines Datenmatrixcodes ausgelöst, die Stanz-Kombimaschine stanzte das Teil, es wurde gleich danach gebogen, geschweisst und schliesslich markiert. Dann kam das für den Besucher persönlich fabrizierte Produkt in die Kommissionierung. Die ganze Produktionszeit über sahen die Besucher auf einem Bildschirm, bei welchem Prozess «ihr Auftrag» im Moment stand.
Inmitten dieser vernetzen Produktion fand eine Podiumsdiskussion der anderen Art statt.
Patrick Gerber, Laserschnitt AG: Der Grund ist ziemlich einfach: Wir haben bemerkt, dass wir den Auftragsabläufen nicht mehr nachkamen. Der erste Gedanke war aber ein eher traditioneller: Wir müssen mehr Leute anstellen!
Patrick Gerber, Laserschnitt AG: Ja, aber es war auch ein Zeitpunkt, der die Möglichkeit bot, etwas Neues zu beginnen und sich zukunftsgerichteter aufzustellen. Wir sind auf das TruTops Fab der Firma Trumpf gestossen, welches gleich mehrere Probleme lösen konnte. Denn wir hatten zum Beispiel in eine neue automatisierte Maschine investiert, welche Aufträge speditiv abarbeiten konnte, aber im Büro betrieben wir einen enormen Zeitaufwand, so dass dies in einem Widerspruch stand. Auch deshalb sagten wir uns: «Jetzt machen wir Industrie 4.0 – und zwar im Büro und in der Produktion.
Roger Bürki, Keller Laser: Ein bisschen ist solch ein Einstieg sicher auch dem Zeitgeist geschuldet, denke ich. Es ist tatsächlich so, dass wenn andere es tun, man sich die Methoden und Tools besser auch einmal anschaut. Denn wie sagt man: «Wer rastet, der rostet.» Und dazu kommt, dass die Maschinen seit Jahren unglaublich schnell sind, aber alle anderen Prozesse hinterherhinken. Also muss zwingend eine Balance entstehen.


Seine Firma hat sich als Weltneuheit ein TruLaser Center 7030 angeschafft, den ersten Vollautomaten für die Laserfertigung, der alle Prozesse – von der Zeichnung bis zum sortierten Teil – in einer einzigen Maschine integriert. Mehr Infos.
Andreas Riguzzi: Wir sind vor zwei Jahren eingestiegen in die digitale Produktion und haben den Auftragseingang digitalisiert, die Mitarbeiter arbeiten mit iPads an den Maschinen und die Maschinen geben direkte Rückmeldungen, wenn die Teile geschnitten sind. Wir haben also vom Büro bis zum Versand bereits vieles digitalisiert, aber wir sind ständig daran, dies zu verbessern. Denn eines ist sicher: Es ist ein Prozess, der nie aufhört.

Für Andreas Riguzzi war der Schritt in die Digitalisierung schon früh durchaus vorstellbar. Denn nicht nur wirtschaftliche und technologische Gründe sprechen dafür. «Ich habe schon früh bemerkt, dass je mehr moderner wir produzieren, umso mehr Kunden lassen bei uns ihre Bleche fertigen.» Als im Jahr 2017 bei der Firma Riguzzi allerdings von einem Tag auf den andern das TruTops Fab die Werkstattleitung übernahm, war er doch ein wenig nervös. Nicht das neue System rief die Nervosität hervor, da hatte er Vertrauen in Trumpf. Er sorgte sich vielmehr um die Mitarbeiter. Werden sie sich zum Beispiel unwohl fühlen, wenn Sie mit den neu eingeführten iPads vor den Maschinen stehen und nicht mit den ihnen vertrauten A4-Papieren? Die ganze Story, warum Andreas Riguzzi in die digitale Produktion einstieg und wie sie ihm hilft, lesen Sie hier.
Andreas Conzelmann, Trumpf: Wir haben im Dialog mit unseren Kunden festgestellt, dass derzeit nur 20 % der Zeit im wertschöpfenden Prozess stattfinden, und die restlichen 80 % in den vor und nachgelagerten Prozessen. Für uns als Hersteller von Werkzeugmaschinen und Softwarelösungen ist deshalb klar: Wir müssen unsere Kunden auch in diesen restlichen Bereichen unterstützen können – und zwar vollständig.


80 % aller Prozesse sind nicht wertschöpfend. Auch in diesem Bereich müssen wir unsere Kunden unterstützen.
Andreas Conzelmann, Trumpf: Das ist so. Aber selbst diese Firmen können sich von einem Tag auf den anderen auf den Veränderungsprozess einlassen, der immer sehr individuell ist. Es gibt Firmen, bei denen fehlt es lediglich an Automatisierungslösungen, andere brauchen sonstige Einzellösungen und wiederum andere eine grosszügige Vernetzung.
Reinhold Gross, Trumpf: Die Digitalisierung wird gerne als Überschrift verwendet, aber ich muss dazu sagen, dass die Digitalisierung nicht das Ziel ist! Das Ziel ist die Prozessentwicklung und die Prozessverbesserungen. Die Digitalisierung ist lediglich ein Hilfsmittel. Und diese Prozessverbesserungen im Unternehmen sind nun keinesfalls etwas, was wir gerade erfunden haben. Wir haben aber nun die zusätzlichen Möglichkeiten gewonnen, die durch Verkettung und Verknüpfung von Maschinen entstanden sind.


Die Digitalisierung ist nicht das Ziel! Das Ziel ist die Prozessentwicklung und die Prozessverbesserungen. Die Digitalisierung ist lediglich ein Hilfsmittel.
Adrian Schär: Nein. Das hat damit zu tun, dass der richtige Zeitpunkt einfach nie kommt. Bei Veränderungsprojekten fehlt es immer an Zeit, daher muss eine Firma diesen Zeitpunkt für sich selber festlegen. Ich finde, die beste Lösung ist: Einfach mal starten! Denn wir als Hersteller wissen um diese Problematik und haben auch aus diesem Grund unsere Angebote so angelegt, dass es modular aufgebaut ist, so dass Kunden alle Möglichkeiten haben: einfach anfangen, schrittweise anpassen oder komplett vernetzt fertigen. So können selbst Firmen mit kleinem Budget einsteigen — und zwar genau dort, wo sie der Schuh am meisten drückt.
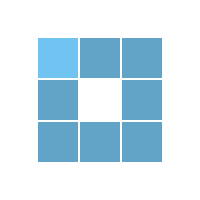
Eines der Beispiele für eine modular aufgebaute Lösung ist das TruTops Fab. Sie steuert und verwaltet alle Prozesse in einem Fertigungsbetrieb und zwar vom Kundenauftrag bis zum Versand. Durch die Anbindung an die Steuerung der Maschinen kann jederzeit der aktuelle Stand der Fertigung erkannt werden. TruTops Fab wird ständig weiterentwickelt und besteht momentan aus diesen Modulen.
Adrian Schär, Trumpf: Das ist sicher so. Zuerst kommt die Prozessverbesserung. Immer. Denn es ist ein verbreiteter Gedankenfehler, dass man dort zu digitalisieren anfängt, wo man das grösste Chaos hat – und zwar in der Hoffnung, dass sich das Chaos dann auflöst. Aber ich kann versprechen: Sie haben dann zwar digitalisiert, aber sie haben dann einfach ein digitalisiertes Chaos.


Herr Schär, gibt es einen optimalen Zeitpunkt für den Einstieg? - Nein.
Andreas Riguzzi, Riguzzi AG: Ich musste! Denn die Firma Trumpf hat uns bei diesem Prozess begleitet und da war es wohl nicht anders möglich. Aber im Ernst: Bei uns war es tatsächlich so, dass wir in Kooperation mit der Firma Trumpf die Prozesse alle abgebildet haben. Danach zeigen sich die Schwachstellen klar und deutlich. Und ich weiss nun aus Erfahrung, dass es genau die Chaosstellen sind, die man eigentlich zuvor schon kannte, aber nicht angehen wollte. Allein schon aus diesem Grund lohnt sich der Einstieg in die Digitalisierung: Weil man zuerst aufräumen muss.
Stefan Brupbacher: Wir haben im Jahr 2016 eine Umfrage gemacht – und auch im 2018. Der Unterschied war gewaltig, aber nicht nur aufgrund der gestiegenen Anzahl an Firmen, die sich damit beschäftigen. Im 2016 befassten sich 75 % mit der Digitalisierung, im Jahr 2018 waren es bereits 94 %. Bei den KMU fand dabei die grösste Entwicklung statt: nämlich von 30 % auf über 80 %.
Aber was uns am meisten freute, war der Wandel der Motivation für Digitalisierungsprojekte: Im 2016 standen die Kostengründen für Digitalisierungsprojekte im Vordergrund. Zwei Jahre später fragten sich die Firmen, welchen Kundennutzen solche Projekte haben.
Andreas Conzelmann, Trumpf: Wir sind tatsächlich daran, neue Modelle zu entwickeln wie zum Beispiel das Pay-per-use-Modell, bei dem wir zum Beispiel nur noch die Maschinennutzungszeit abrechnen. Die Voraussetzung ist natürlich eine entsprechende Transparenz, damit wir in der Lage sind, im Order-to-Cash-Prozess die ganze Fakturierung automatisiert ablaufen lassen können.
Reinhold Gross, Trumpf: Wir sind in einer Phase, in der wir vieles noch testen. Wir haben momentan auch ein paar Maschinenfunktionen, die wir als Mietoptionen anbieten. Man kauft sich also nicht mehr zum Beispiel das Gewindeformen bei der Stanzmaschine, sondern man mietet diese Funktion bei Bedarf. Bei einem Maschinentyp bieten wir eine Pay-per-Use-Funktion an. Wir testen damit, wie dies auf dem Markt ankommt und bauen auch unsere internen Prozesse dafür auf.
Patrick Gerber, Laserschnitt AG: Eigentlich schon, denn wir haben die Idee, unsere Maschinen gut auszulasten. Ich vermiete ja auch meine Stunden an meine Mitbewerber. Wenn ich Maschinenfunktionen mieten könnte, würde ich das sicher prüfen. Aber ich gebe auch gerne zu, dass ich natürlich lieber alles bei mir im Hause habe, und das ist wahrscheinlich bei uns allen so. (Lachen im Publikum)


Die Firma Laserschnitt ist in Uetendorf beheimatet und verfügt über einen ansehnlichen Maschinenpark. Denn die Firma bietet Laserschneiden, Plasmaschneiden, Abkanten, Schweissen und auch das Trovalisieren in einer Rotations-Trovalisiermaschine an.
XaaS ist eines dieser Schlagworte, das momentan einen Hype erlebt bei der Suche nach neuen Geschäftsmodellen. X steht dabei für «irgendetwas» und so heisst die Wortkombination nichts weniger als «Alles Mögliche as a Service» daher. Oder in anderen Worten: Business-Abos. Diese machen durchaus Sinn, denn auf diese Weise können gebundene finanzielle Mittel minimiert werden. Solche Geschäftsmodelle sind bereits im Einsatz. Die Firma Caterpillar zum Beispiel bietet ihre Baumaschinen im Abo an. Auch die Firma Trumpf sucht neue Geschäftsmodelle und testet diese auch. Eine Option sind die Maschinenfunktionen als Abo. Das bedeutet, dass Kunden eine Maschinenfunktion zuerst kostenlos testen können und danach diese einfach mieten. Diese Lizenzierung auf Zeit hat für Kunden ganz konkrete Vorteile:
Andreas Riguzzi, Riguzzi AG: Ich nehme fest an, dass es in Zukunft eine bestimmte Berechtigung haben wird. Denn das Investitionsvolumen in unserer Branche ist extrem hoch, da könnten solche Modelle sicherlich helfen, die Kosten in den Griff zu bekommen. Aber ich würde auch sagen, dass Stand heute es wohl eher schwierig ist, ein solches Modell durchzusetzen. Einerseits bräuchte man sicherlich noch mehr Entscheidungsgrundlagen, anderseits ist es wahrscheinlich wirklich so, dass wir – noch – gerne alles in der Firma haben und nicht irgendwann zumieten wollen, wenn man es braucht.


Die Firma Riguzzi investiert in Folge des Wachstums neu in eine Highspeed-Biegemaschine TruBend 7036 und in TruBend 7050. Seit die Firma in die digitalisierte Blechbearbeitung eingestiegen ist, sind für Andreas Riguzzi bei einem Kauf nicht mehr die Geschwindigkeit der Maschinen entscheidend, sondern die Software, die Steuerung und die Durchgängigkeit.
Reinhold Gross, Trumpf: Zwei Funktionen bieten wir bereits an. Es ist also schon etwas mehr als nur eine Idee. Konkret geht es darum, dass man bei diesen Funktionen nur für die Zeit bezahlt, in der sie aktiv genutzt werden.
Und weil vorher noch die Frage war zu den Daten: Das ist nicht so kritisch, wie sich das anhört. Denn kritisch werden meist Daten im Unternehmen gesehen, die im Zusammenhang mit einem Kundenauftrag stehen, aber die benötigen wir nicht. Für die Steuerung brauchen wir immer nur maschinenbezogene Daten. Diese Daten kann man sauber trennen.
Stefan Brupbacher, Swissmem: Wenn man die Zahlen 2018 ansieht, müssen die Rahmenbedingungen hervorragend gewesen sein. Wir hatten in der MEM-Industrie ein Umsatzplus von 11% und ein Plus von 5.6% im Auftragseingang. Aber ab Mitte Jahr gab es einen Bruch und die Zukunft wird uns fordern. Damit rücken die Rahmenbedingungen ins Zentrum. Mit einem Exportanteil von 80% heisst das, dass wir einen möglichst guten Marktzugang brauchen. Deshalb kämpft Swissmem an vorderster Stelle für das Rahmenabkommen mit der EU.
Damit zu den Rahmenbedingungen für neue Geschäftsmodelle wie «Pay per use». Solche sind nötig. Die Diskussion hier und anderswo zeigt, wo die Herausforderungen sind: beim Vertrauen gegenüber den Daten und ihren Verwendern. Wir als Verband müssen prüfen, welche Datenrichtlinien es generell geben muss, damit das Vertrauen der Firmen untereinander, aber auch zu den Konsumenten gesichert ist. Ohne dieses Vertrauen sind viele dieser Businessmodelle nicht möglich. Aber statt weiterer Regulierungen möchten wir, dass die Wirtschaft diese Herausforderung selber mit einem eigenen Datenkodex löst.


Bevor der promovierte Jurist Stefan Brupbacher Ende 2018 zum Swissmem-Direktor gewählt wurde, war er Generalsekretär des WBF unter Bundesrat Johann Schneider-Ammann, der selbst bis zu seiner Wahl in den Bundesrat Swissmem-Präsident war.
Besucher: Also bei den Rahmenbedingungen hätte ich schon etwas hinzuzufügen: Da müssen Regulatorien abgebaut werden und zwar so viele wie möglich. Aber ich habe eine Frage noch zum «Pay per use»-Modell: Wie viel müsste so eine Maschine genutzt werden, dass es sich lohnt? Sie müssten ja eine Art Mindestnutzungsdauer einführen, sonst ist es für Trumpf nicht sehr interessant, oder?
Andreas Conzelmann, Trumpf: Da haben Sie Recht, aber wir als Hersteller werden ein wenig ins Risiko gehen müssen, denn sonst wird das Angebot vielleicht nicht so attraktiv. Die dahintersteckende Logik bei diesem Angebot ist, dass eine Maschine mit sehr geringer Auslastung einen höheren Stundensatz hat. Wer mehr Stundenkontingente dazukauft, wird diese für einen immer günstigeren Preis bekommen. So wird ein Geschäftsmodell daraus, dass für uns und den Anwender am vielversprechendsten ist und wo das Interesse am grössten ist, die Maschine so gut wie möglich auszulasten.
Eugen Albisser, Moderator: Mit den neuen Geschäftsmodelle stehen wir in der Industrie erst am Anfang und sie werden uns noch lange beschäftigen. Während also Firmen wie Trumpf sich in einer Art Vorreiterrolle an neue Modelle herantasten, werden andere Firmen noch abwarten. Und einige Firmen sind erst auf dem Weg dahin, sich den Einstieg in die Digitalisierung zu überlegen. Ihnen allen hoffen wir, ein paar Inputs gebracht zu haben mit dieser Diskussionsrunde.
Text
Eugen Albisser, Technik und Wissen
Bilder
Ruben Sprich
Produktion Multimedia
Sebastian Hanig, Technik und Wissen
Eine Produktion von «Technik und Wissen» im Auftrag der Trumpf Schweiz AG, www.trumpf.com
Landingpage
Trumpf und die Messe Ble.ch
www.trumpf.com/s/nceq8t
Veröffentlicht am: