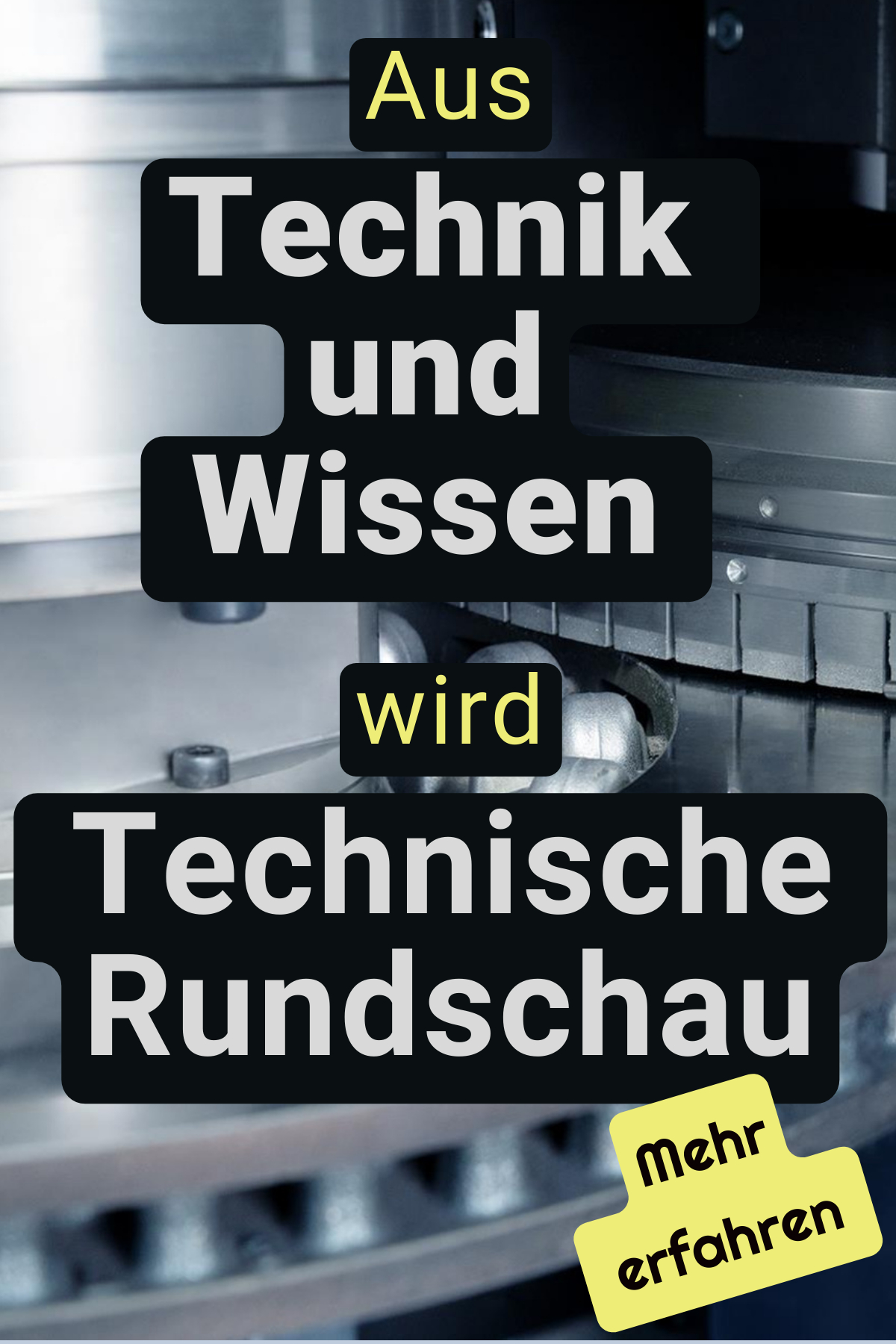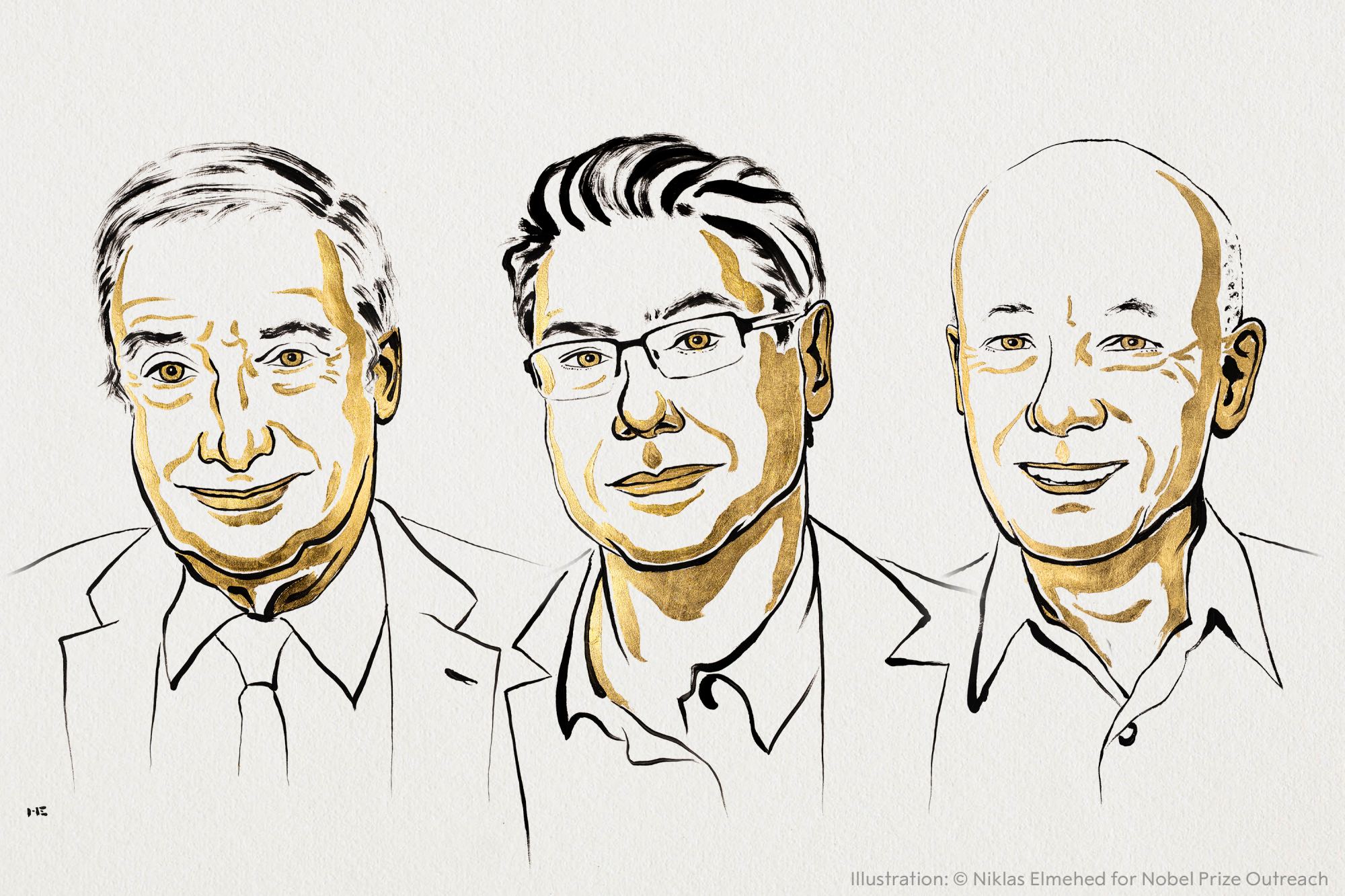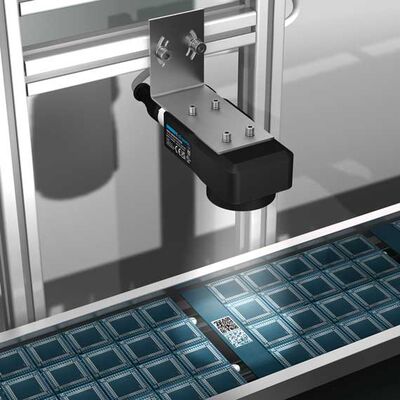Jahrhundertelang bewegte sich das wirtschaftliche Leben in engen Bahnen. Zwar gab es Fortschritte, etwa den Buchdruck oder das Mikroskop. Doch sie blieben meist isolierte Ereignisse. Der Lebensstandard stagnierte. Technische Neuerungen versandeten. Erst mit der Industriellen Revolution, vor rund 200 Jahren, änderte sich das. Seither ersetzt eine Innovation die nächste. Ein Zyklus wirtschaftlicher Erneuerung wurde zur neuen Normalität. Der diesjährige Wirtschaftsnobelpreis geht an drei Forscher, die erklären, wie dieser Wandel möglich wurde und worauf er beruht.
Eine historische Perspektive: Joel Mokyr
Der Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr, Professor an der Northwestern University und an der Universität Tel Aviv, wird für seine Erklärung ausgezeichnet, warum Wachstum heute nicht mehr versiegt wie einst. Seine zentrale These lautet: Erst als wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Technik enger zusammenspielten, konnte Innovation dauerhaft wirtschaftliche Wirkung entfalten.
Vor der Industriellen Revolution stützten sich technische Errungenschaften vor allem auf Erfahrungswissen. Mokyr nennt dieses Wissen «prescriptive knowledge». Es sagt, wie etwas funktioniert, nicht aber warum. Ohne theoretische Fundierung blieben viele Entdeckungen singulär und schwer reproduzierbar. Mokyr stellt dem das «propositional knowledge» gegenüber. Es beschreibt systematisch die Gesetzmässigkeiten der Natur und liefert Erklärungen. Erst als diese beiden Wissensformen einander ergänzten, entstand jener selbstverstärkende Prozess, der heute als moderner technologischer Fortschritt gilt.
Die Rolle der Gesellschaft
Wissen allein genügt jedoch nicht. Für Innovation braucht es laut Mokyr auch eine Gesellschaft, die Wandel zulässt. In seiner Analyse der Industriellen Revolution zeigt er: Widerstand gegen Neues war über Jahrhunderte weit verbreitet. Zünfte, Fürsten und andere privilegierte Gruppen wehrten sich gegen Veränderungen. Erst mit neuen Institutionen, etwa dem britischen Parlament, wurden Interessenkonflikte verhandelbar. Damit wurde technischer Wandel politisch tragfähig.
Diese Offenheit ist zentral für einen Prozess, den der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter als schöpferische Zerstörung bezeichnete. Neue Technologien verdrängen bestehende Strukturen. Ohne gesellschaftliche Toleranz würden sich Interessen durchsetzen, die Innovation verhindern. Mokyr betont, dass wirtschaftliches Wachstum nur gelingen kann, wenn eine Gesellschaft bereit ist, Altes loszulassen.
Das Modell der kreativen Zerstörung: Aghion und Howitt
Diese These greift das zweite prämierte Forscherduo auf. Philippe Aghion, Professor in Paris und London, sowie Peter Howitt von der Brown University entwickelten 1992 gemeinsam ein ökonomisches Modell, das den Mechanismus der Innovation formalisiert. Ihr Modell beschreibt, wie Unternehmen durch neue Produkte oder effizientere Prozesse andere verdrängen. Wachstum entsteht dadurch, dass immer wieder neue, bessere Lösungen auf den Markt kommen.
Diese Dynamik ist produktiv, aber auch konflikthaft. Unternehmen verlieren Marktanteile, Arbeitsplätze verschwinden. Gleichzeitig entstehen neue Chancen. Entscheidend ist, dass der Innovationsanreiz erhalten bleibt. Dazu braucht es funktionierende Märkte, Schutzrechte für Erfinderinnen und Erfinder sowie sozialpolitische Absicherung für Betroffene.
Wissen als Wachstumsmotor
Sowohl Mokyr als auch Aghion und Howitt sehen im Wissen die zentrale Ressource für Wachstum. Mokyr analysiert die historischen Bedingungen, unter denen Wissen produktiv wurde. Aghion und Howitt modellieren die ökonomische Dynamik, in der Wissen zu Innovation wird. Ihre Ansätze ergänzen sich. Gemeinsam zeigen sie, warum moderne Volkswirtschaften kontinuierlich wachsen können.
Implikationen für Politik und Industrie
Was bedeutet diese Forschung für die Praxis? Erstens: Fortschritt ist kein Selbstläufer. Staaten und Gesellschaften müssen die Bedingungen für Innovation aktiv gestalten. Dazu gehören Wettbewerb, Forschung, Bildung und ein rechtlicher Rahmen, der unternehmerisches Handeln ermöglicht.
Zweitens: Wissen muss sich verbreiten können. Nur wenn neues Wissen zugänglich ist, etwa durch Bildung, offene Forschung oder Technologietransfer, kann es Wirkung entfalten. Aghion und Howitt zeigen, dass selbst kleine Änderungen, etwa bei Patentschutz oder staatlicher Förderung, das Innovationsverhalten von Unternehmen stark beeinflussen können.
Drittens: Der Fortschritt bleibt verletzlich. Mokyr warnt vor einem Rückfall in die Stagnation, falls das Vertrauen in Wissenschaft schwindet oder der Zugang zu Bildung eingeschränkt wird. Auch politische Kräfte, die Wandel blockieren wollen, können das Innovationssystem gefährden.