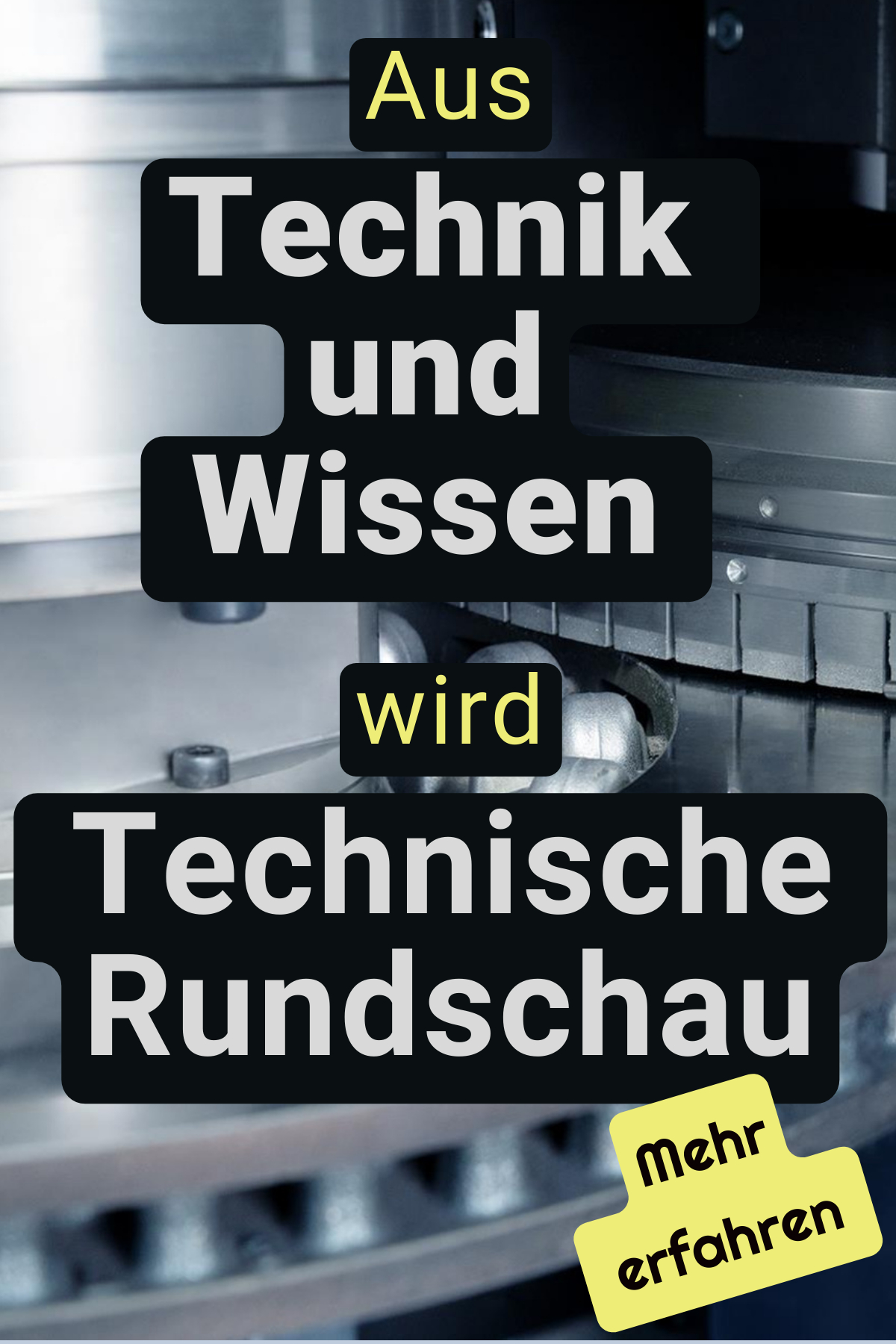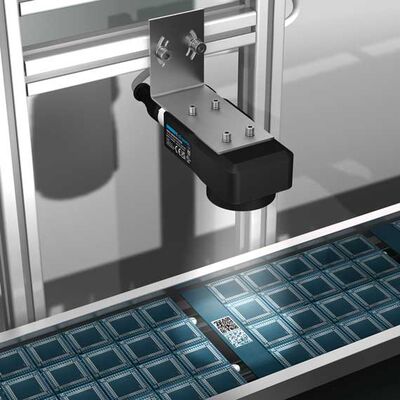Jacques Lemire brachte es am Swissmem-Symposium auf den Punkt: Humanoide Roboter sind ein Milliardenversprechen – aber auch ein Definitionsproblem. Heute kostet ein Modell bis zu 175'000 Dollar und verbraucht 500 Watt, nur um geradeaus zu laufen. China drängt mit 120 Projekten vor, während Europa noch Standards sucht. Lemires Fazit: Die Chancen sind riesig, die Hürden ebenso – und die eigentliche Herausforderung bleibt der Mensch.

Die Robotik verspricht eine neue industrielle Revolution – und ringt gleichzeitig um die Frage, was «humanoid» überhaupt bedeutet. Jacques Lemire, Vizepräsident der American Gear Manufacturers Association, erklärte am Swissmem-Symposium, warum es so schwer ist, einen Markt vorherzusagen, den es noch gar nicht gibt.
Als Medienpartner des Symposiums war die «Technische Rundschau» (Technik und Wissen*) mitten im Geschehen und berichtet in einer Serie über die wichtigsten Vorträge und Roundtable-Gespräch. *Die «Technische Rundschau» gehört neu zu «Technik und Wissen». Ab 2026 bündeln wir alles unter der Traditionsmarke «Technische Rundschau» - auch diese Webseite.
Der Elevator Speech zum Vortrag
Wie viele humanoide Roboter wird es in naher Zukunft geben? Die Schätzungen reichen von wenigen Tausend bis zu weit über 150'000 Einheiten – und genau darin liegt das Problem. «Die Bandbreite ist enorm, weil niemand genau sagen kann, was ein Humanoid überhaupt ist», erklärte Jacques Grenier, Vice Chairman der American Gear Manufacturers Association (AGMA), am diesjährigen Swissmem-Symposium.
Mit spürbarer Ironie bringt Grenier die Absurdität dieser Unsicherheit auf den Punkt: «Wenn ich meinem CEO sagen würde, dass wir planen, zwischen 6’000 und 160’000 humanoide Roboter zu verkaufen, würde sie mich wohl anschauen und sagen: Geh nach Hause.»
Die Aussage trifft den Nerv eines Marktes, der in Bewegung ist – aber noch keine klaren Konturen kennt.
Was ist ein Humanoid?
Die Unsicherheit beginnt also schon beim Begriff. Ist ein Cobot ein Humanoid? Ein autonomer Transportroboter? Ein humanoider Roboter mit zwei Beinen, zwei Armen, Gesicht und Sprache? «Fragen Sie 160 Leute, und Sie erhalten 160 Antworten», so Lemire. Selbst ISO und IEEE, die an Standards arbeiten, haben noch keine Definition gefunden.
Und die Idee ist älter, als viele glauben: Das Wort «Roboter» wurde 1920 geprägt, der erste humanoide Roboter 1973 gebaut. Während Industrieroboter seither eine beispiellose Erfolgsgeschichte geschrieben haben, blieb die Entwicklung der humanoiden zurück. Die Gründe liegen nicht allein in der Technik, sondern auch in der Unklarheit, was ein «menschlicher» Roboter eigentlich leisten soll.
Die Kostenfalle
Noch gravierender ist die ökonomische Diskrepanz: Derzeit kostet die Herstellung eines humanoiden Roboters 125’000 bis 175’000 Dollar – mit über 25 Aktuatoren, Sensoren, Getrieben, Motoren. Um massentauglich zu werden, müsste der Preis aber auf 5’000 bis 10’000 Dollar sinken. «Das ist ein weiter Weg», sagte Lemire trocken. Und er warnte vor den allzu glänzenden Showroom-Bildern: «Glauben Sie nicht alles, was Sie auf YouTube sehen.»
Der Flaschenhals liegt im Mechanischen
Software, Sensorik, künstliche Intelligenz – all das entwickelt sich rasant. NVIDIA etwa hat einen Chip speziell für humanoide Roboter angekündigt. Doch die Mechanik bleibt der Engpass: Getriebe, Motoren, Aktuatoren. «Man kann kein Viertel eines Zahnrads fräsen», erinnerte Grenier sein Publikum, «es dauert so lange, wie es dauert.» Hier liegt paradoxerweise eine Chance für Europa und die Schweiz: In der Präzisionsmechanik ist man nach wie vor Weltspitze.

Die Kostenfalle
Noch gravierender ist die ökonomische Diskrepanz: Derzeit kostet die Herstellung eines humanoiden Roboters 125’000 bis 175’000 Dollar – mit über 25 Aktuatoren, Sensoren, Getrieben, Motoren. Um massentauglich zu werden, müsste der Preis aber auf 5’000 bis 10’000 Dollar sinken. «Das ist ein weiter Weg», sagte Lemire trocken. Und er warnte vor den allzu glänzenden Showroom-Bildern: «Glauben Sie nicht alles, was Sie auf YouTube sehen.»
Der Flaschenhals liegt im Mechanischen
Software, Sensorik, künstliche Intelligenz – all das entwickelt sich rasant. NVIDIA etwa hat einen Chip speziell für humanoide Roboter angekündigt. Doch die Mechanik bleibt der Engpass: Getriebe, Motoren, Aktuatoren. «Man kann kein Viertel eines Zahnrads fräsen», erinnerte Grenier sein Publikum, «es dauert so lange, wie es dauert.» Hier liegt paradoxerweise eine Chance für Europa und die Schweiz: In der Präzisionsmechanik ist man nach wie vor Weltspitze.
China zieht voran
Während in Europa noch Definitionen gesucht und Businesspläne geschrieben werden, investiert China massiv in humanoide Robotik. Der Grund ist nicht nur geopolitisch, sondern auch demografisch: Junge Chinesinnen und Chinesen wollen nicht mehr in Fabriken stehen und iPhones zusammenschrauben. Über 120 Firmen arbeiten dort an humanoiden Robotern – «es ist der Wilde Westen», so Lemire. Das schafft Vielfalt, aber auch Chaos.
Und dann das vielleicht verblüffendste Detail: Ein Tesla-Roboter benötigt derzeit 500 Watt – nur um geradeaus zu laufen. Nicht die Motoren sind das Problem, sondern die Rechenleistung. Hochgerechnet auf Hunderttausende Maschinen würde das Stromnetze in die Knie zwingen. Lemire: «Wir dürfen uns von Bildern aus Showrooms nicht täuschen lassen – die wirkliche Herausforderung steckt in der Physik.»
Das Problem des Humanoiden ist der Mensch
Am Ende landete Grenier wieder bei uns selbst: Kinder, die einen Roboter in der Kita umstossen. Pflegekräfte, die keine 40 Stunden Training absolvieren wollen, nur um mit einer Maschine zu interagieren. Und Investoren, die sich blenden lassen von glatten Showroom-Videos auf YouTube. «Die meisten dieser Roboter laufen nur unter streng kontrollierten Bedingungen», warnte Grenier. «Das Problem des Humanoiden ist am Ende der Mensch.»
Der Traum vom humanoiden Roboter bleibt aber faszinierend. Doch noch überwiegen Definitionsfragen, Kostenfallen und Energieprobleme. «Wir haben Zeit», sagte Grenier am Schluss – nüchtern, beinahe lakonisch. Ein Satz, der zweierlei bedeutet: Die Technik entwickelt sich, aber langsamer als die Schlagzeilen versprechen. Und vielleicht ist genau diese Entschleunigung eine Chance – für die Industrie, für die Gesellschaft und für den Menschen, der noch immer das Mass aller Dinge bleibt.
Impressum
Text: Eugen Albisser
Bilder: Swissmem
Informationen
Firma
Weitere Artikel
- Automation
- Digitalisierung
- Event
- Künstliche Intelligenz
- Maschinenbau
- Robotik
- Swissmem
- Werkzeugmaschinen
- Wirtschaft
Veröffentlicht am: