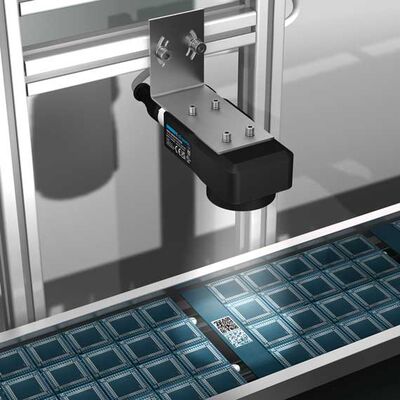Noch bevor Claude Maurer das Rednerpult am Swissmem-Symposium betrat, war der Rahmen seines Vortrags mit drei Z-Wörtern abgesteckt: «Zölle, Zinsen, Zukunftssorgen». Drei Begriffe, die das Publikum sofort fesselten, weil sie wie ein Brennglas die Ängste einer exportorientierten Volkswirtschaft bündelten.
Das Trump-Rätsel
Maurer sprach, wie es gute Prognostiker tun: mit dem Mut zum Zweifel. «Wer behauptet, Trump prognostizieren zu können, der hat Trump nicht verstanden», sagte er gleich zu Beginn. Das Lächeln im Saal war zustimmend, aber nicht beruhigend. Denn hinter der Pointe steckt ein strukturelles Problem: Die Unsicherheit ist systemisch geworden.
Der Referent führte es an einem simplen Beispiel vor: einer Zahlenreihe, die mit 1, 2, 3 beginnt. Die naheliegende Fortsetzung sei 4, doch ebenso plausibel wären 3, 2 oder wieder 1. Der Punkt war klar: Die Zukunft folgt keiner linearen Logik. Extrapolation taugt nicht – Szenarien sind das Gebot der Stunde.
Wenn 0,3 Prozent zum Problem werden
In einem dieser Szenarien bleiben die US-Strafzölle von 39 Prozent bestehen. Maurers Modell zeigt: Die Schweizer Wirtschaft würde pro Jahr 0,3 Prozentpunkte Wachstum verlieren – rund 2,5 Milliarden Franken an Löhnen und Gewinnen. Keine Katastrophe, aber spürbar: 12’500 Arbeitsplätze stünden im Feuer, zuerst in der Technikindustrie, dann auch in anderen Branchen. Maurer nannte es eine «Industrierezession».
Das klingt abstrakt, bis man den Zinseszinseffekt bedenkt: Jahr für Jahr ein bisschen weniger Lohn, und bald summiert sich daraus ein Wohlstandsverlust, den selbst die Agilität der Schweizer Wirtschaft nicht mehr wegsteckt.
Vom Welthandel zum Weltrisikospiel
Noch gefährlicher als der unmittelbare Schaden ist der Stimmungswandel. Unsicherheit lähmt Investitionen, erklärte Maurer, und zitierte John Maynard Keynes’ «Animal Spirits». Wer heute nicht investieren muss, verschiebt Entscheidungen – und produziert damit morgen nicht. Das Ergebnis: weniger Bedarf an Maschinen, weniger Aufträge, weniger Wachstum.
Trump, so Maurer, sei dabei nicht der Erfinder des Protektionismus, sondern ein Katalysator einer Entwicklung, die schon lange läuft: Das Ende der Globalisierungsdividende. Statt offener Märkte nun Industriepolitik, Abschottung, Nearshoring. Die Welt zerfällt in Blöcke: China, USA, andere Mächte. Für ein kleines Land wie die Schweiz eine gefährliche Lage: «Es droht, dazwischen zerrieben zu werden.»
Dauerhafte Zölle, dauerhafte Begehrlichkeiten
Maurer führte vor, dass Zölle nicht nur Strafen sind, sondern auch Staatsfinanzierung. Die USA generieren derzeit rund 350 Milliarden Dollar jährlich aus Zöllen. Das ist ein Tropfen auf den heissen Stein angesichts eines Defizits von 2000 Milliarden, aber genug, um Begehrlichkeiten zu wecken. Seine Prognose: Zölle von 10 bis 15 Prozent werden bleiben, selbst wenn die 39 Prozent für Schweizer Produkte fallen sollten. «Das nennt man Anchoring: Zum Glück nur 15 Prozent – obwohl es absurd hoch ist.»
Die eigentliche Ursache, das chronische Leistungsbilanzdefizit der USA, löst sich damit nicht. Im Gegenteil: Während die Amerikaner mehr konsumieren, als sie produzieren, hat die Schweiz einen Sparüberschuss. Und genau dieser Überschuss, so Maurer, erklärt die «sicheren Prognosen»: tiefe Zinsen, starker Franken, tiefe Inflation.
Das Rezept gegen die Zollwut
Damit war das Publikum wieder bei der Schweiz selbst. Während die Industrie eine Rezession spürt, profitieren Bau, Immobilien und der Staat von billigen Krediten und stabiler Nachfrage. Für Unternehmen, die auf den Binnenkonsum setzen, könnte das sogar ein Vorteil sein.
Doch Maurer warnte vor Illusionen: Standortverlagerungen in die USA seien keine Lösung, dort seien Migration, Bildung und Staatsfinanzen kaum besser. Sein Schluss war schlicht und klar: «Das einzige Rezept gegen die Zollwut ist die Verringerung der Regulierungswut hierzulande.»
Ein Satz, der hängen blieb, weil er so unpathetisch wie pragmatisch klang.