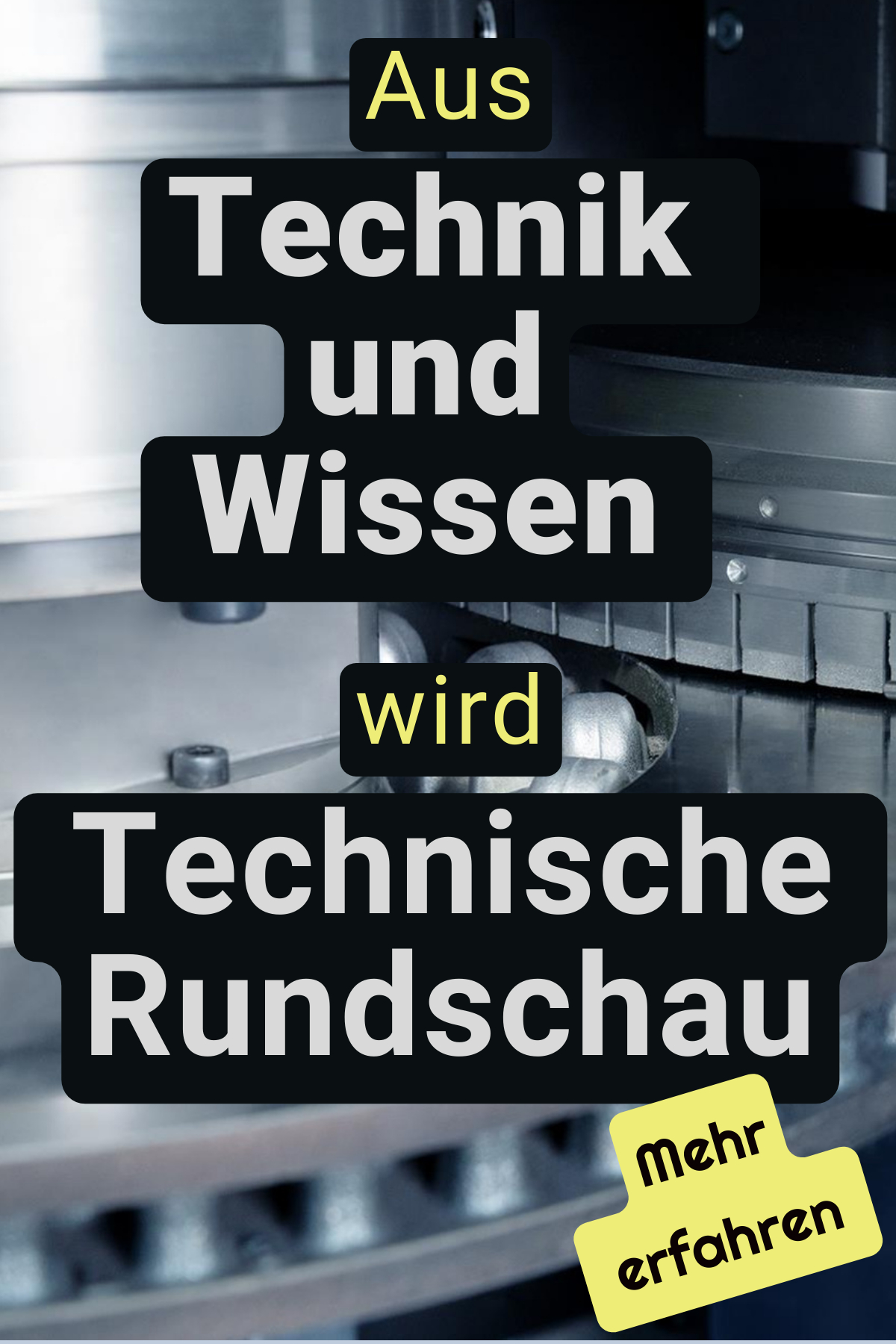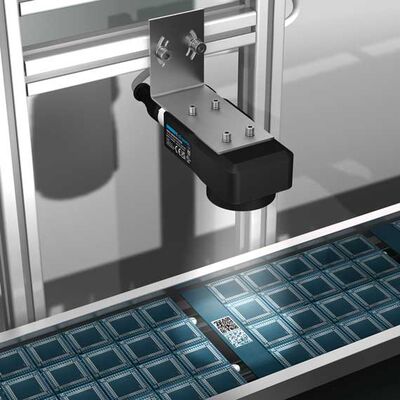Warum man KI nicht fürchten muss
TEDxZHAW-Vortrag von KI-Professor Thilo Stadelmann
Bei seinem TEDxZHAW-Auftritt rief Thilo Stadelmann, Professor für Künstliche Intelligenz an der ZHAW, dazu auf, weniger Angst vor der Technologie selbst zu haben – und stattdessen unseren eigenen Umgang mit ihr kritisch zu hinterfragen.
Redaktion: Eugen Albisser
Textquelle: Thilo Stadelmann
Künstliche Intelligenz ist ein Thema, das Menschen fasziniert – und gleichzeitig verunsichert. Das gilt nicht nur für Laien, sondern auch für Fachpersonen. Kein Wunder: Die Diskussion darüber ist längst nicht mehr nur eine Sache technischer Details, sondern ein Gemisch aus Emotionen, Weltanschauungen und popkulturellen Erzählungen.
In seinem Vortrag mit dem Titel «How not to fear AI», der bald auf der TED-Plattform erscheinen soll, aber bereits als Transkript online verfügbar ist, geht Stadelmann genau diesem Spannungsfeld auf den Grund. Seine Botschaft: Angst vor KI ist oft irrational – und selten technisch begründet.
Von Deep Blue bis TESCREAL: Vorstellungen prägen unsere Wahrnehmung
Stadelmann beginnt mit einem Schachspiel, das Geschichte schrieb: 1997 verlor Garri Kasparov gegen den IBM-Supercomputer Deep Blue. Doch entscheidend war nicht die Technik – sondern Kasparovs Reaktion. Er interpretierte eine harmlose Programm-Panne als Beweis übermenschlicher Intelligenz und verlor die Nerven. Für Stadelmann ein Paradebeispiel dafür, wie sehr unsere Erwartungen und Annahmen unser Verhalten steuern können.
Heute sei es ähnlich, meint er: Vieles, was wir an Künstlicher Intelligenz beängstigend finden, stamme nicht aus der realen Entwicklung, sondern aus Erzählungen – etwa aus der Science-Fiction oder ideologischen Konzepten wie dem Transhumanismus. Der Begriff TESCREAL fasst diese Strömungen zusammen. Was sie gemeinsam haben? Eine skeptische Sicht auf den Menschen als fehlerhaftes Wesen, das Maschinen früher oder später ablösen sollen. Technisch und wissenschaftlich bleibt diese Haltung allerdings höchst umstritten.
Was KI wirklich kann – und was nicht
Weg von der Vision, hin zur Realität: Technisch gesehen ist KI kein denkendes Wesen, sondern ein statistisches Werkzeug. Vor allem beim maschinellen Lernen werden aus riesigen Datenmengen Muster abgeleitet, um scheinbar «intelligente» Leistungen zu vollbringen – sei es beim Bildverstehen oder beim Textgenerieren.
Doch diese Systeme arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten, nicht mit Verständnis. Das illustriert Stadelmann mit einem klassischen Rätsel, das im Original so lautet: «Ein Chirurg, welcher der Vater des Jungen ist, sagt, er könne diesen Jungen nicht operieren, er sei sein Sohn. Wer ist der Chirurg für den Jungen?» Die Antwort sollte geradlinig sein und ist sogar im Text enthalten. Doch weil im Internet viele Variationen des Rätsels vorhanden sind, die mit der geschlechterspezifischen Voreingenommenheit spielen und den Zusatz « … welcher der Vater des Jungen ist …» nicht enthalten, strauchelt nun auch die KI und wird etwa antworten: «Der Chirurg ist die Mutter des Jungen.»
Sprachmodelle wie GPT-4 analysieren zwar gewaltige Datenmengen, bleiben aber letztlich stochastische Papageien – clever, aber ohne echtes Begreifen.
Menschen sind keine Modelle – und umgekehrt
Hier setzt Stadelmanns zentrale These an: KI denkt nicht wie ein Mensch. Sie kann einzelne Fähigkeiten täuschend echt nachbilden, aber das grosse Ganze bleibt ihr fremd. Oder, wie Stadelmann es formuliert: KI verhält sich zum Menschen ähnlich wie ein DJ zum Musiker – Musikerzeugung wird hier mit so anderen Methoden simuliert, dass viele Aspekte des Musizierens prinzipiell weit jenseits der Kapazität des DJs liegen.
Anstatt uns zu ersetzen, sollte KI uns unterstützen. Der Begriff «Künstliche Intelligenz» greife daher zu kurz – treffender wäre «Erweiterte Intelligenz» (Extended Intelligence): eine Technik, die menschliche Fähigkeiten ergänzt statt überflüssig macht.
Risiken und Gegenstrategie
Ganz ohne Risiken ist KI natürlich nicht. Stadelmann nennt zwei besonders reale Gefahren, aber auch gleich die dazugehörige Strategie, um gegen diese zwei Möglichkeiten zu obsiegen. Zuerst die Risiken:
- Vorauseilender Gehorsam: Wir überlassen Entscheidungen Maschinen, obwohl deren Kompetenz begrenzt ist.
- Bequemlichkeit: Wer sich zu stark auf KI verlässt, verlernt eigene Fähigkeiten – und damit auch Selbstbestimmung.
Doch diese Gefahren seien menschengemacht – und entsprechend vermeidbar. «Wenn Sie sagen können: Ich bin wunderbar gemacht. Ich habe Fähigkeiten, Beziehungen, Würde – dann fürchten Sie sich nicht vor einem Werkzeug», bringt es Stadelmann auf den Punkt.
Passend zu diesem Artikel
Impressum
Textquelle: Thilo Stadelmann
Bildquelle: ZHAW
Redaktionelle Bearbeitung: Technik und Wissen
Informationen
Weitere Artikel
Veröffentlicht am: